Operette
| Artikel: |
die |
| Mehrzahl: |
Operetten |
| Beschreibung: |
heiteres, musikalisches
Bühnenstück, das meist nicht "so ernst" gemeint ist |
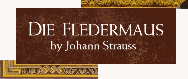 Der
Walzerkönig Johann Strauß meinte über die Operette: "Wenn
eine Operette populär werden soll, muß jeder etwas nach seinem
Geschmack darin finden. Für Leute, die kein Klavier haben, muß
man es fein anstellen, daß ihnen von der Vorstellung etwas im Gedächtnis
bleibt."
Der
Walzerkönig Johann Strauß meinte über die Operette: "Wenn
eine Operette populär werden soll, muß jeder etwas nach seinem
Geschmack darin finden. Für Leute, die kein Klavier haben, muß
man es fein anstellen, daß ihnen von der Vorstellung etwas im Gedächtnis
bleibt."
Careful who you come onto at parties,
it just might be your wife.
Ask who isn't fooling around in this story and there will
be a slim show of hands. Rosalinde, her husband Eisenstein, their maid,
and a host of other foolhardy townsfolk bring their frivolous infidelities
to a peak during a wild night of imbibing at a lavish party.
Shameless flirting, fibs and unfaithful couples have
never been so amusing. Die Fledermaus is loved for its playful fun and
timeless portrayal of human behavior.
Zur Übersetzungshilfe:
fooling
around - Zeit vertrödeln / slim show of hands - dürftiges (Hand)zeichen
/ maid - hier: Dienstmädchen / a host of foolhardy townsfolk - eine
Menge tollkühner Stadtleute / frivolous infidelities - leichtsinnige
bzw. frivole Untreue / peak - Spitze bzw. Gipfel / imbibing - Einsaugen/sich
zu eigen machen / lavish - verschwenderisch / fibs - Schwindeleien / couple
- Paar / amusing - amüsant / playful - scherzhaft / portrayal - Schilderung
/ behavior - Verhalten.
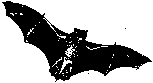
Zum Inhalt der Operette
Entscheidend für den sich erst zwei Jahre nach der Uraufführung
einstellenden Erfolg der Operette (UA am 5. April 1874) war die Musik:
Tolle melodische Ideen, einprägsame Tanzlieder, hervorragende Instrumentierung
und musikalische Charakterisierung der einzelnen Rollen.
 Die
Handlung gründet sich auf ihre Vorgeschichte: Gabriel von
Eisenstein (Tenor) hatte nach einer langen Faschingsnacht den mit ihm befreundeten
Notar Dr. Falke in originellem Fledermauskostüm im Park seinen Rausch
ausschlafen lassen und ihn so dem Gespött der Passanten ausgesetzt.
Seitdem wurde er "Doktor Fledermaus" genannt. Jetzt hat Falke Gelegenheit
zur Rache: Er über-bringt Eisenstein eine Einladung des für seine
Feste bekannten russischen Prinzen Orlofsky. Der will Eisenstein unbedingt
Folge leisten , obwohl er an jenem Abend eine Arreststrafe wegen eines
Beleidigungsdeliktes antreten soll. Heuchlerisch nimmt er Abschied von
seiner Gemahlin Rosalinde, nicht wissend, daß der Gesangslehrer und
frühere Geliebte Alfred (ebenfalls Tenor) schon darauf wartet, es
sich bei ihr bequem zu machen. Doch das Schäferstündchen der
beiden wird durch den Gefäng-nisdirektor Frank gestört, der den
nicht zum Arrest erschienenen Hausherren persön-lich abholen will.
Er ist in Eile, denn auch er ist zum Fest des Prinzen eingeladen. Alfred
will Rosalinde nicht bloßstellen und läßt sich als ihr
Gatte inhaftieren. Im Palais Orlofskys werden Eisenstein und Frank dem
Prinzen als französische Aristo-kraten vorgestellt. Aber auch andere
Gäste treten unter falscher Identität auf, so zum Beispiel eine
maskierte "ungarische Gräfin".
Die
Handlung gründet sich auf ihre Vorgeschichte: Gabriel von
Eisenstein (Tenor) hatte nach einer langen Faschingsnacht den mit ihm befreundeten
Notar Dr. Falke in originellem Fledermauskostüm im Park seinen Rausch
ausschlafen lassen und ihn so dem Gespött der Passanten ausgesetzt.
Seitdem wurde er "Doktor Fledermaus" genannt. Jetzt hat Falke Gelegenheit
zur Rache: Er über-bringt Eisenstein eine Einladung des für seine
Feste bekannten russischen Prinzen Orlofsky. Der will Eisenstein unbedingt
Folge leisten , obwohl er an jenem Abend eine Arreststrafe wegen eines
Beleidigungsdeliktes antreten soll. Heuchlerisch nimmt er Abschied von
seiner Gemahlin Rosalinde, nicht wissend, daß der Gesangslehrer und
frühere Geliebte Alfred (ebenfalls Tenor) schon darauf wartet, es
sich bei ihr bequem zu machen. Doch das Schäferstündchen der
beiden wird durch den Gefäng-nisdirektor Frank gestört, der den
nicht zum Arrest erschienenen Hausherren persön-lich abholen will.
Er ist in Eile, denn auch er ist zum Fest des Prinzen eingeladen. Alfred
will Rosalinde nicht bloßstellen und läßt sich als ihr
Gatte inhaftieren. Im Palais Orlofskys werden Eisenstein und Frank dem
Prinzen als französische Aristo-kraten vorgestellt. Aber auch andere
Gäste treten unter falscher Identität auf, so zum Beispiel eine
maskierte "ungarische Gräfin".
Eine alte Inhaltsangabe besagt, im ersten
Akt wird das Netz gesponnen, in welch-em im zweiten Akt alle zappeln, und
im dritten Akt wird es entwirrt...!
Mit dem Ball und Maskenfest bei Orlofsky (2. Akt) erreicht
die Operette ihren Höhe-punkt: Mittelpunkt ist die große Walzer-Szene.
Unerkannt und doch zum Teil er-kannt, treffen sich in Orlofskys Palast
Eisenstein, Rosalinde und Adele. Alle drei ha-ben ein böses Gewissen
und müssen voreinander Versteck spielen, denn Eisenstein schwindelte
seiner Frau vor, er müsse sofort eine Gefängnisstrafe absitzen
(in Wahrheit verschob er den Strafantritt auf den nächsten Morgen).
Rosalinde ihrerseits empfing im ersten Akt ihren alten Verehrer Alfred,
der in Abwesenheit des Hausherrn als vermeintlicher Eisenstein wegen Beleidigung
einer Amtsperson zum Arrest abgeholt wird; endlich: Adele als Mitwisserin
wechselseitiger Verfehlungen hat sie es leicht - im Abendkleid der Dame
des Hauses erschien auch sie als "junge Künstlerin" bei Orlofsky.
Der Gipfel der (unwahrscheinlichen) Verwechslung ist erreicht, wenn sich
Eisenstein in die eigene (maskierte) Frau verliebt, die ihrem Gatten eine
kostbare Repetieruhr abzuschwindeln weiß; nun hat sie das "Corpus
delicti" in Händen!
Lenker des ganzen Spiels ist Eisensteins Freund Dr. Falke,
der auch den Gefängnisdirektor unter dem Namen eines Chevalier Chagrin
in Orlofskys Gesellschaft einzuführen wußte. Solistischer Glanzpunkt
der von Rosalinde gesungene Csàrdàs. Alles kommt an den Tag,
und alles bleibt doch in der Schwebe - dies die spannende Situation beim
Finale des zweiten Aufzuges.
Den dritten Akt beherrscht der mürrische, dem Alkohol
verfallene Gefängnisaufseher Frosch. Unter sehr eifersüchtigen
Temperamentsausbrüchen wird vor allem die Rechnung zwischen den beiden
Ehegatten geregelt. Das Ende ist beschwipste Seligkeit im Gefühl der
glücklich geretteten Moral des gegenseitigen Verstehens und Vergebens.
 Und
nochmals eine Zusammenfassung: Am 5. April 1874 wurde in Wien die
"Fledermaus" von Johann Strauß uraufgeführt. Es ist die Geburtsstunde
der wohl bis heute bekanntesten Operette überhaupt. Selbst ansonsten
eingeschworene Operetten-"Muffel" lassen die "Fledermaus" als glückliche
Ausnahme gelten: Das Stück ist sowohl musikalisch wie auch dramaturgisch
eben ein großer Wurf.
Und
nochmals eine Zusammenfassung: Am 5. April 1874 wurde in Wien die
"Fledermaus" von Johann Strauß uraufgeführt. Es ist die Geburtsstunde
der wohl bis heute bekanntesten Operette überhaupt. Selbst ansonsten
eingeschworene Operetten-"Muffel" lassen die "Fledermaus" als glückliche
Ausnahme gelten: Das Stück ist sowohl musikalisch wie auch dramaturgisch
eben ein großer Wurf.
Das wurde vom eher zurückhaltend reagierenden Wiener
Uraufführungspublikum allerdings noch gar nicht so richtig erkannt.
In jenen Jahren hatten die Wiener Bürger wirtschaftliche, soziale
und nationale Probleme , die sie gar nicht so für das champagnerselige
Motto der "Fledermaus" empfänglich machte:
"Glücklich ist, wer vergißt, was doch nicht
zu ändern ist!"
Drei Vorgeschichten führen zu den irrwitzigen Verwechslungen
und Verwirrungen der chaotischen Stunden vom frühen Nachmittag bis
zum späten Morgen, die die "Fledermaus" beschreibt.
Erstens: Vor einigen Jahren spielte Gabriel von Eisenstein
seinem Freund, dem Notar Dr. Falke, einen üblen Streich. Nach dem
Besuch eines feucht-fröhlichen Maskenballs ließ Eisenstein Dr.
Falke im Kostüm einer Fledermaus im Stadtpark seinen Rausch ausschlafen.
Am Morgen mußte der Notar unter dem Gespött der Kleinstadtbürger
nach Hause wanken. Diese Blamage will Dr. Falke heute seinem Freund heimzahlen...
Zweitens: Gabriel von Eisenstein hat sich leider kürzlich
mit einem Beamten der Kleinstadt in Wort und Tat ungebührlich angelegt.
Die ihm deshalb auferlegte Strafe von acht Tagen Gefängnis muß
er heute Abend antreten...
Drittens: Gerade heute taucht dann auch noch der etwas
abgewrackte Tenor Alfred im Hause Eisenstein auf, der vor Jahren mit Eisensteins
Gattin Rosalinde ein "Techtelmechtel" hatte und nun an diese vergangenen
Zeiten anknüpfen möchte. Um einen Krach zu vermeiden, verspricht
Rosalinde Alfred ein Rendezvous am späteren Abend, wenn ihr Gatte
im sicheren Gefängnis ist...
Zur weiteren Verwirrung des Abends tragen das Stubenmädchen
Adele mit ihren eigenen Zukunftsplänen und der völlig unfähige
Anwalt Eisensteins, Dr. Blind bei.
Im Laufe des Abends spielt jeder jedem Komödie vor
und jeder/jede schlüpft in eine andere Identität. Das geht leider
nur begrenzt gut. Am Morgen kommt die Ernüchterung...
Johann Strauß: Die Fledermaus
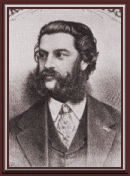
Für Johann Strauß bedeutete Styling ebensoviel wie
für die Stars der Gegenwart (seinen verschiedenen Bärten widmete
er besondere Aufmerksamkeit). So wurde sein unveränderliches (?!)
Aussehen zum Markenzeichen einer Kultur des gehobenen Amusements. Die Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts bevorzugte es nämlich, Krisensituationen durch
Entspannung bei Tanz, Oper und Operette mit bisweilen opulenter (®
prächtiger/ üppiger) Musik und Ausstattung zu verdrängen. Gerade dieser Walzer aus der Fledermaus
- Ouvertüre (1874) zeigt Strauß' Technik, an feingliedrige,
nachsingbare Phrasen immer neue Motive zu fügen und harmonisch transparent
zu begleiten, ohne auf Nuancierungen im Moll-Bereich zu verzichten. Der
Suggestion (® sich freiwillig beeinflussen
lassen) scheinbar endloser Bewegung in froher Stimmung wollte man sich
nicht entziehen. (nach M. Saary)
und Ausstattung zu verdrängen. Gerade dieser Walzer aus der Fledermaus
- Ouvertüre (1874) zeigt Strauß' Technik, an feingliedrige,
nachsingbare Phrasen immer neue Motive zu fügen und harmonisch transparent
zu begleiten, ohne auf Nuancierungen im Moll-Bereich zu verzichten. Der
Suggestion (® sich freiwillig beeinflussen
lassen) scheinbar endloser Bewegung in froher Stimmung wollte man sich
nicht entziehen. (nach M. Saary)

Michael Jackson gibt sich die Ehre
Operetten sind kitschig. Und albern. Und oberflächlich.
Und überhaupt. Die Gattung steht in dem zweifelhaften Ruf, zwar das
Publikum in vergleichsweise großen Scharen anzulocken, aber über
mäßige Unterhaltung hinaus wenig zu bieten. Wir haben leider
auch schon zur Genüge Aufführungen gesehen, die dieses Klischee
bestätigen.
(...) Als besondere Pointe erscheint Orlofsky - der für
seine Feste bekannte russische Prinz - nicht zufällig in Gestalt von
Michael Jackson. Das gibt einige Lacher und fügt sich auch
recht gut in das Regiekonzept, bleibt aber letztendlich ein Gag am Rande.
(...)
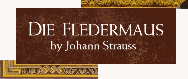 Der
Walzerkönig Johann Strauß meinte über die Operette: "Wenn
eine Operette populär werden soll, muß jeder etwas nach seinem
Geschmack darin finden. Für Leute, die kein Klavier haben, muß
man es fein anstellen, daß ihnen von der Vorstellung etwas im Gedächtnis
bleibt."
Der
Walzerkönig Johann Strauß meinte über die Operette: "Wenn
eine Operette populär werden soll, muß jeder etwas nach seinem
Geschmack darin finden. Für Leute, die kein Klavier haben, muß
man es fein anstellen, daß ihnen von der Vorstellung etwas im Gedächtnis
bleibt."
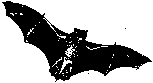
 Die
Handlung gründet sich auf ihre Vorgeschichte: Gabriel von
Eisenstein (Tenor) hatte nach einer langen Faschingsnacht den mit ihm befreundeten
Notar Dr. Falke in originellem Fledermauskostüm im Park seinen Rausch
ausschlafen lassen und ihn so dem Gespött der Passanten ausgesetzt.
Seitdem wurde er "Doktor Fledermaus" genannt. Jetzt hat Falke Gelegenheit
zur Rache: Er über-bringt Eisenstein eine Einladung des für seine
Feste bekannten russischen Prinzen Orlofsky. Der will Eisenstein unbedingt
Folge leisten , obwohl er an jenem Abend eine Arreststrafe wegen eines
Beleidigungsdeliktes antreten soll. Heuchlerisch nimmt er Abschied von
seiner Gemahlin Rosalinde, nicht wissend, daß der Gesangslehrer und
frühere Geliebte Alfred (ebenfalls Tenor) schon darauf wartet, es
sich bei ihr bequem zu machen. Doch das Schäferstündchen der
beiden wird durch den Gefäng-nisdirektor Frank gestört, der den
nicht zum Arrest erschienenen Hausherren persön-lich abholen will.
Er ist in Eile, denn auch er ist zum Fest des Prinzen eingeladen. Alfred
will Rosalinde nicht bloßstellen und läßt sich als ihr
Gatte inhaftieren. Im Palais Orlofskys werden Eisenstein und Frank dem
Prinzen als französische Aristo-kraten vorgestellt. Aber auch andere
Gäste treten unter falscher Identität auf, so zum Beispiel eine
maskierte "ungarische Gräfin".
Die
Handlung gründet sich auf ihre Vorgeschichte: Gabriel von
Eisenstein (Tenor) hatte nach einer langen Faschingsnacht den mit ihm befreundeten
Notar Dr. Falke in originellem Fledermauskostüm im Park seinen Rausch
ausschlafen lassen und ihn so dem Gespött der Passanten ausgesetzt.
Seitdem wurde er "Doktor Fledermaus" genannt. Jetzt hat Falke Gelegenheit
zur Rache: Er über-bringt Eisenstein eine Einladung des für seine
Feste bekannten russischen Prinzen Orlofsky. Der will Eisenstein unbedingt
Folge leisten , obwohl er an jenem Abend eine Arreststrafe wegen eines
Beleidigungsdeliktes antreten soll. Heuchlerisch nimmt er Abschied von
seiner Gemahlin Rosalinde, nicht wissend, daß der Gesangslehrer und
frühere Geliebte Alfred (ebenfalls Tenor) schon darauf wartet, es
sich bei ihr bequem zu machen. Doch das Schäferstündchen der
beiden wird durch den Gefäng-nisdirektor Frank gestört, der den
nicht zum Arrest erschienenen Hausherren persön-lich abholen will.
Er ist in Eile, denn auch er ist zum Fest des Prinzen eingeladen. Alfred
will Rosalinde nicht bloßstellen und läßt sich als ihr
Gatte inhaftieren. Im Palais Orlofskys werden Eisenstein und Frank dem
Prinzen als französische Aristo-kraten vorgestellt. Aber auch andere
Gäste treten unter falscher Identität auf, so zum Beispiel eine
maskierte "ungarische Gräfin".
 Und
nochmals eine Zusammenfassung: Am 5. April 1874 wurde in Wien die
"Fledermaus" von Johann Strauß uraufgeführt. Es ist die Geburtsstunde
der wohl bis heute bekanntesten Operette überhaupt. Selbst ansonsten
eingeschworene Operetten-"Muffel" lassen die "Fledermaus" als glückliche
Ausnahme gelten: Das Stück ist sowohl musikalisch wie auch dramaturgisch
eben ein großer Wurf.
Und
nochmals eine Zusammenfassung: Am 5. April 1874 wurde in Wien die
"Fledermaus" von Johann Strauß uraufgeführt. Es ist die Geburtsstunde
der wohl bis heute bekanntesten Operette überhaupt. Selbst ansonsten
eingeschworene Operetten-"Muffel" lassen die "Fledermaus" als glückliche
Ausnahme gelten: Das Stück ist sowohl musikalisch wie auch dramaturgisch
eben ein großer Wurf.
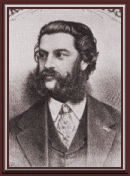
 und Ausstattung zu verdrängen. Gerade dieser Walzer aus der Fledermaus
- Ouvertüre (1874) zeigt Strauß' Technik, an feingliedrige,
nachsingbare Phrasen immer neue Motive zu fügen und harmonisch transparent
zu begleiten, ohne auf Nuancierungen im Moll-Bereich zu verzichten. Der
Suggestion (® sich freiwillig beeinflussen
lassen) scheinbar endloser Bewegung in froher Stimmung wollte man sich
nicht entziehen. (nach M. Saary)
und Ausstattung zu verdrängen. Gerade dieser Walzer aus der Fledermaus
- Ouvertüre (1874) zeigt Strauß' Technik, an feingliedrige,
nachsingbare Phrasen immer neue Motive zu fügen und harmonisch transparent
zu begleiten, ohne auf Nuancierungen im Moll-Bereich zu verzichten. Der
Suggestion (® sich freiwillig beeinflussen
lassen) scheinbar endloser Bewegung in froher Stimmung wollte man sich
nicht entziehen. (nach M. Saary)
